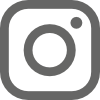Mitteilungsblatt Nordheim
Neues aus Nordheim und Nordhausen (Archiv)
Dieser Artikel befindet sich im Archiv!
Geschichte des Monats Mai
Erfasst von: Zimmermann, Sandra | 05.05.2022 – 19.05.2022
Das Alltagsleben in der Landwirtschaft im 19. Und 20. Jahrhundert (Teil 2)
Ein großes Ereignis war die Hausschlachtung, die in der Regel in den Wintermonaten erfolgte. Meistens holte man schon am Vortag das Schlachtgeschirr (Wanne, Schragen, Gestell usw.) beim Hausmetzger ab, damit am Schlachttag früh am Morgen alles sauber und ordentlich bereitstand. Wenn der Metzger eintraf, kochte das Wasser im Kessel schon. Ein Teil der Wurst wurde in Därme abgefüllt, ein anderer Teil des Fleisches und der Wurst kam in Dosen. Alles musste aber im Kessel gekocht werden, damit es haltbar blieb. Außerdem gab es noch die Möglichkeit, Fleisch als Salzfleisch oder Rauchfleisch haltbar zu machen. Etwas einfacher wurde die Haltbarmachung und Vorratshaltung mit dem Bau der Gemeinschaftsgefrieranlage 1957 in der Alten Kelter. Dort konnte nun vor allem Fleisch eingefroren werden. Am Ende des Schlachttages brachte man Nachbarn, Freunden und Verwandten, manchmal auch dem Pfarrer und/oder dem Lehrer eine Kanne mit „Kesselbrühe“, mit Nudeleinlage auch „Metzelsuppe“ genannt. Das war die Brühe aus dem Kessel, in dem Fleisch und Wurst gekocht wurde. Manche Wurst platzte dabei auf, sodass durchaus auch festes „Material“ in der Suppe schwamm. Dazu gab es noch ein Stück Kesselfleisch und ein paar frische Würste.
Da der Bauernhaushalt weitgehend ein Selbstversorgungsbetrieb war, spielte neben der Hausschlachtung auch die Haltbarmachung verschiedener Lebensmittel wie Eier und Kraut sowie

Leiterwagen mit Brotlaib

Backhaus in der Wassergasse
das Brotbacken eine wichtige Rolle. Mehl hatte man aus dem eigenen Getreide in der Mehltruhe, die nötige Hefe gab es früher nicht abgepackt als Würfel, man holte sie „offen“ bei der Backfrau oder beim Bäcker. Ausgebacken wurden die fertigen Laibe im Backhaus oder beim Bäcker. Die gebackenen Brotlaibe kamen im Keller aufs von der Decke herabhängende Brotbrett, und wenn sich beim letzten Laib bereits Schimmel angesetzt hatte, schnitt man eben ein Stück der Rinde weg und gab den Abfall den Hühnern oder den Schweinen zum Fressen.
Zu dem bereits erwähnten Kesselfleisch und den frischen Leber und Blutwürsten passte natürlich selbstgemachtes Sauerkraut aus dem Steinguttopf hervorragend. Entweder baute die Bäuerin das Kraut im eigenen Garten selbst an, oder es wurde von einem der durchreisenden Filderkrautbauern gekauft, die durch die Dörfer des Unterlandes fuhren und ihre Ware auf der Straße mit dem lauten Ruf „Filderkraut“ anboten. Manche Haushalte besaßen einen eigenen Krauthobel, ansonsten bestellte man jemanden, der einen solchen besaß, oder lieh einen Krauthobel aus. Mit einem speziellen Strunkstecher schnitt man den Strunk in der Mitte des Krautkopfes heraus, danach konnte mit dem Hobeln des Krautes begonnen werden. In den Krautständer legte man zuunterst eine Schicht ganze Krautblätter, darauf kam eine Schicht geschnittenes Kraut, danach Salz und eine Prise Zucker, manchmal auch ein wenig Kümmel. Nun musste das Ganze kräftig gestampft werden bis sich Brühe bildete. Dann kam die nächste Schicht
Kraut und wieder Salz und ein wenig Zucker. Abermals musste gestampft werden. Dieser Vorgang wiederholte sich, bis der Ständer beinahe voll oder alles Kraut im Ständer eingebracht war. Es folgte eine Abdeckung mit Krautblättern. Zum Schluss legte man ein passgenaues Holzbrett in den Ständer und beschwerte dieses mit einem schweren Stein. Etwa 6--8 Wochen musste das Kraut jetzt gären, dann wurden der Stein, das Brett und die großen Abdeckblätter entfernt. Jetzt legte man ein sauberes leinenes Tuch auf das fertige Kraut, darauf kam das inzwischen gewaschene Brett und zur Beschwerung wieder der Stein. Von da an war das Kraut für den Verzehr geeignet.

Zu einer deftigen Schlachtplatte mit Kraut, Wurst und Kesselfleisch gehörte natürlich auch das entsprechende Getränk aus dem eigenen Keller. Ein weit verbreiteter Haustrunk war früher der Most. Die Äpfel und Birnen der Streuobstwiesen am Rande des Dorfes wurden im Herbst von den Bäumen geschüttelt und in eine der örtlichen Mostereien gebracht. Dort wurden sie gewaschen, zerkleinert und zu Saft gepresst. Mit dem beladenen Fasswagen der Mosterei fuhr man anschließend heim und ließ dort den Saft mittels eines Schlauches in die sauber geputzten Fässer im Keller fließen. Zum Schluss setzte man den Gärspund auf die Einfüllöffnung des Fasses und der Gärprozess konnte beginnen. Ein guter Most konnte sich bei kühler Lagerung durchaus einige Jahre frisch erhalten. Der übriggebliebene Most wurde vor allem ab der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg in der Brennerei zu Branntwein bzw. Obstschnaps gebrannt. Der Most war das Getränk während des Tages und während der Arbeit. Nach Feierabend oder am Sonntag war man allerdings dem einen oder anderen Krüglein Wein aus dem Keller auch nicht abgeneigt.
Im Winter legen Hühner wenige oder gar keine Eier. Deshalb wurden im Spätsommer und Herbst Eier gesammelt und für den Winter konserviert. Als Konservierungsmittel verwendete man früher gelöschten Kalk oder sogenanntes „Wasserglas“. Die Eier wurden dazu in Steinguttöpfen im Vorratsraum oder im Keller gelagert. Dazu sollten die Eier sauber, aber möglichst nicht nass gewaschen sein (trocken abbürsten). Man schichtete sie mit der Spitze nach unten in ein Steingutgefäß und füllte anschließend die Wasserglas--Lösung oder das Kalkwasser ein. Bei der Wasserglas--Methode werden die Poren der Eierschale aufgefüllt. So wird das Ei vor Mikroorganismen, Wasser und Luft geschützt und ist somit länger haltbar. Die Konservierung der Eier durch Kalkwasser erfolgt durch die Ablagerung von Kalk auf der Eierschale. So wird diese ebenfalls gegen Luft, Bakterien und Wasser abgedichtet. Diese so eingelagerten Eier faulten zwar nicht, aber der Geschmack und die Qualität litten dennoch etwas. Sie hielten sich etwa drei bis sechs Monate lang und man verwendete sie hauptsächlich zum Backen oder Kochen, weniger als Frühstücks-- oder Spiegelei.

Ein nicht so beliebter Tag war der Waschtag. Es gab früher ja weder Waschmaschinen noch Wäschetrockner, und das Waschen der teilweise durch die Arbeit in Feld und Stall stark verschmutzten Kleidung war sehr mühsam und aufwändig und dauerte je nach Größe des Haushaltes oft auch mehrere Tage.

Deshalb wurde auch nicht jede Woche, sondern eher alle vier Wochen „große Wäsche“ gewaschen. Die Dreckwäsche kam zunächst in einen Holzbottich oder in eine Zinkwanne zum Einweichen in Seifenlauge. Auf dem Waschbrett rieben
die Frauen nun die Wäschestücke hin und her. Danach kam die Wäsche noch einmal in den Waschzuber und wurde schließlich gespült. Kochwäsche wurde in einem großen, mit Holz beheizten Kessel zum Kochen gebracht. Bevor es Wäscheschleudern gab, benutzte man eine Spindelpresse, die ähnlich aussah wie eine Obstpresse, um das Wasser aus der Wäsche zu pressen.

Zum Glätten drehte man einzelne Wäschestücke durch die hölzerne Bügelwalze. Man konnte auch außer Haus bei der Waschfrau waschen, zum Beispiel in der Rathausgasse bei Frau Geiger („Wäschmarie“) oder bei Frau Strenkert in dem Gebäude neben der Schmiede Frank. Dazu meldete man das Waschen erst an und brachte dann am Waschtag in der Regel auch noch das Feuerholz mit. Während die Wäsche kochte, sprang man rasch zu Fräulein Eberle in der Brackenheimer Straße hinüber und bestellte dort das Mangeln. War das Waschen beendet, fuhr man mit dem Leiterwagen und der Wäsche heim, um die Wäsche zum Trocknen aufzuhängen. In den Tagen danach fuhr man diese wieder per Leiterwagen in die Brackenheimer Straße, um in der Mangelstube bei Fräulein Eberle die Bettwäsche und die Tischtücher glätten zu lassen. Insgesamt war ein großer Aufwand erforderlich, um saubere und gebügelte Wäsche im Schrank zu haben. Bei manchen kam speziell zum Waschtag auch eine Waschfrau zum Helfen. Auch für das Nähen und Flicken gab es Frauen im Dorf, die man für diese Arbeiten bestellen konnte. Das Nähen und Ausbessern von Kleidungsstücken war aber meistens eine Arbeit für die Wintermonate. In dieser Jahreszeit wurden auch immer wieder Koch-- und Nähkurse für junge Frauen angeboten, um diese für ihren künftigen eigenen Haushalt vorzubereiten.

Kochkurs

Nähkurs
Eine Winterarbeit war auch das Flechten von Weidenkörben, das einige Männer im Dorf beherrschten. Beim Sortieren der Weiden, die man zum Anbinden der Reben benötigte, suchte man die schönsten Weidenruten heraus, um damit Körbe und Zainen zu flechten. Manche Männer arbeiteten während der Wintermonate auch als Hilfskräfte bei örtlichen Handwerkern oder bei der Gemeinde. Auch das Holzmachen im eigenen Wald oder in Lohnarbeit im Gemeindewald war eine Winterbeschäftigung, ebenso die Vorbereitungen zur Neuanpflanzung von Weinbergen.
Das Leben auf dem Bauernhof früher war so vielfältig, dass in diesem Bericht unmöglich alle Aspekte aus dem Alltagsleben in der Landwirtschaft dargestellt werden konnten. Aber ein gewisser Ein-- und Überblick konnte vielleicht gegeben und einige Erinnerungen geweckt werden.
Ulrich Berger
/resources/ecics_5868.pdf